Doves – The Universal Want

Eine Dekade Pause hat den Doves die nötige Lockerheit zurückgegeben, um in Form von The Universal Want mit einem zweiten Debütalbum ins Comeback zu starten, das auch ansatzlos an den Tugenden der vier Vorgängerwerke anzuknüpft.
„It’s never enough“ singt Jimi Goodwin im Titelsong der Platte hinter einer Reihe existenzialistischer Fragen, wohlwissend, dass seine eigene Band, eine der besten der 00er Jahre über die Insel-Grenzen hinaus, nach 2009 eben doch erst einmal genug hatte. Während sogar Elbow damals doch noch eine unwahrscheinliche Weltkarriere gestartet hatten, stagnierte zumindest der Erfolg der Kritikerlieblinge aus Manchester gefühltermaßen trotz solcher Hits wie Kingdom of Rust oder Black & White Town als Britrock-Meister im exklusiven Schatten vieler spektakulärerer Kollegen, auch im Schatten der eigenen vorausgegangenen Werken.
Mit zumindest einem unsterblichen Meisterwerk und drei herausragenden Glanztaten im Portfolio verabschiedeten sich Doves jedenfalls vor knapp einem Jahrzehnt beinahe klammheimlich in eine Schaffenspause, zu der das Understatement des nunmehrigen Auftauchens nur zu gut passt. Zumal die Solowege von Jimi Goodwin und den Williams-Brüdern als Black River doch auf subtile Weise vorführten, dass die Magie der Doves unerreichbar ist, man eben niemals genug von der ureigenen Anmut, Grandezza und Klasse, der Band haben konnte, die sich da nun auch wieder so selbstverständlich über 48 Minuten ausbreitet, mit einem solch heimeligen Gefühl der Vertrautheit, als wäre diese zeitlos über den Dingen stehende Band nie weggewesen.
Man ist also unmittelbar drinnen, in diesem Kosmos aus formvollendeter Akribie im tiefgreifenden Sound, der detaillierten Produktion, der imaginativen Ästhetik und einem stets majestätisch orientierten Songwriting. Wohl wirklich wie proklamiert wieder ein klein wenig näher an der Zeit, als die Doves Ende der 90er gerade erst aus den House-Überresten für Lost Souls als Phönix aus der Asche stiegen. Weniger, weil der Titelsong von der Klavierballade in die dezente Opulenz wächst, dort mit stolzer Bedächtigkeit marschiert und letztendlich bis in den schrubbelnd-schnipselnden Club heult. Sondern, weil synthetische und elektronisch programmierte Elemente die Texturen der Platte unaufdringlich, aber unterbewusster anreichern, als noch auf den beiden direkten Vorgängeralben.
Zudem gehen die potenten Singles wieder entspannter von der Hand, wo auf Some Cities und Kingdom of Rust vielleicht keine Ermüdungserscheinungen, aber zumindest eine gewisse Verkrampfung rund um die zugegebenermaßen überragenderen Hits anzumerken war.
Nun aber passiert die Stafette an Ohrwürmern wieder als natürlichste Sache der Welt, ohne Zwang. I Will Not Hide hat etwas unbeschwert gleitendes, verspielt federnde, lässt sich hinten raus in seine verträumten Klangwelten fallen und artikuliert eine gedämpften Euphorie. Broke Eyes schichtet die nostalgischen Pop-Melodie in den Himmel unter dem wundervollen Sternenmeer, beschwingt aber uneilig, bis die Streicher subtil glitzern. For Tomorrow scheint zuerst in die Intimität abzutauchen, pflegt dann aber doch eine geradezu gelöste Leichtigkeit, einen beschwingten Optimismus: „From tomorrow we will live again/ For tomorrow, we can see hope/ No more sorrow, you will love again“
Ein beinahe zu unvermittelt auftauchender nebulösen Mittelteil schafft Raum, um in den Nuancen hinten raus einen Chor anzudeuten, bevor Prisoners flott und akustisch getrieben nach vorne zieht; catchy, geschmeidig und zugänglich, mit subversiven Chören und rockigen Gitarren. Cycle of Hurt tänzelt hingegen mit globalem Flair so liebenswürdig, wie Coldplay das nicht mehr können – orchestral ausgeleuchtet schwadroniert dazu die psychedelische Leadgitarre.
Allesamt Songs, die vielleicht weniger Instant-Magie ausstrahlen, als manches frühere Aushängeschild, aber eben auch aus dem Stand weg den Eindruck vermitteln, ohne jedes Ablaufdatum bestehen zu können. Ausflüge wie der Funk in Mother Silverlake (mit weitläufigen Gesang von Jez Williams, einem hibbeligen Bass sowie einer ätherischen, retrofuturistischen Patina) oder der Dub im brillanten Cathedrals of the Mind (das sich lange Zeit nimmt, in ein tiefes, dunkles, schweres Licht getaucht ist vom Rhythmus geerdet wird, über den die Gitarre erhebend aufsteigt, so wärmend und vertraut, bevor ein doomjazziger Bläser-Part sich kurz um sich selbst dreht) lockern das Spektrum zudem auf, sorgen für eine abwechslungsreiche Kurzweiligkeit in der Homogenität.
Noch überragender ist da nur der schlichtweg brillante Opener Carousels, der (auch wieder ein Aspekt der Wurzelsuche) auf einem zeitlosen Groove-Sample von Tony Allen gebaut elegisch im Ambient-Meer badet, die Melodien bedächtig und majestätisch ausbreitet. Im Chorus funkeln die Gitarren auf diesem Grower, der seine Sehnsucht auf akribischer Architektur baut. Die Tiefe der Texturen und Fülle der Details Ist schon hier immanent wichtig, der Nachhall erhaben, die Dynamik lässt kaum stillsitzen.
Dass der Platte zuletzt bis zum Schlusspunkt Forest House, einer dieser abgdämpft pulsierenden-pochenden Mitternachtsballaden mit astralem Flair, im abschließenden Drittel ein wenig die Luft ausgeht und The Universal Want trotz variabler Facetten ohne Über-Songs ein wenig beiläufiger agiert, lässt sich gerade im Kontext des Gesamtwerkes leicht verschmerzen: Doves haben hier in Summe womöglich ihr drittbestes Album aufgenommen.

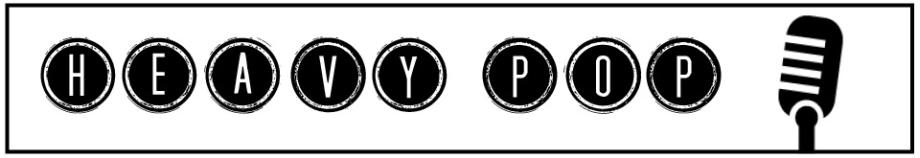
1 Trackback