Black Mountain – Destroyer

Stephen McBean hat endlich den Führerschein gemacht. Die personell umbesetzten Black Mountain treten auf Destroyer deswegen demonstrativ cruisend auf das Gaspedal der Heavyness, lassen dabei aber die Raffinesse, Tiegfründigkeit und Vielseitigkeit vergangener Tage zurück.
Eine Platte über das Autofahren also, die der Zukunft entgegenzubrausen versucht: Die elementaren Mitglieder Amber Webber und Joshua Wells sind mittlerweile ausgeschieden, dafür sind jetzt Rachel Fannan (Sleepy Sun) und Adam Bulgasem (Dommengang) an Bord, John Congleton sitzt nun am Produzentenstuhl und alte Kumpels wie Kliph Scurlock (Flaming Lips) oder Kid Millions (Oneida) schauen vorbei. Letztendlich zählt für Destroyer aber beinahe ausschließlich der Input von Jeremy Schmidt (der seine analogen Synth-Anstriche nicht mehr subversiv über den Äther legen muss, sondern ganz frontal um Songs hängt) hinter Leitwolf und Führerscheinneuling McBean, der seine Erfüllungsgehilfen mit Tatendrang und kaum zu bändigender Freiheitsliebe auf den endlosen Highway schickt.
Dass der Bandboss die Richtung mehr denn je mit Scheuklappen nach vorne richten lässt macht Sinn, haben es Black Mountain nach ihrem formvollendeten Geniestreich In the Future doch auch durch das immer wieder wechselnde Personalkarussell offenbar aufgegeben, dessen Essenz noch einmal in derart makellose Balance zu bekommen – und spalten ihre DNA seitdem immer wieder gleich auf. Wo das schmissige Wilderness Heart den Rock der Band in ein eingängiges Pop-Spektrum tauchen durfte, stand bei IV die spacige Psychedelik im Vordergrund. Und Destroyer? Unterstreicht die 70s-Heavyness und den Rock in der Band-Essenz.
Das mächtige Future Shade als (unter dem unwuchtigen Mix schwächelndes) Signature-Muskelspiel gibt kompakt in den Fußspuren von Sabbath wandelnd den mit retrofuturischen Synthieschwaden drückenden Kompass – schade nur, dass der Refrain spätestens bei der finalen Wiederholung bereits nervt und Fannan im Gegensatz zum kreativen Gegenpol Webber eher ein Gimmick für den Hintergrund ist, das Puristen zufriedenstellen soll. Ein solider Beginn jedenfalls.
Horns Arising zieht das Tempo als schwerfällig Groove mit glimmernden Vintage-Keyboard danach hoch, ein geschmeidiger Doomrocker mit Haltung. Doch die Stimmen sind mit Vocodereffekten belegt – was nach mehrmaligen Genuss verdaulicher, aber nicht unbedingt besser wird. Zumindest macht der (instrumental starke) Song hinten raus fein auf, gerade der akustisch intime Folk-Mittelteil ist schick, bevor Closer to the Edge ein modulierte Eno-Intermezzo darstellt, das ohne rezitierenden Sprechgesang als reiner Ambient besser funktioniert hätte.
High Rise macht seine Sache als repetiv-stampfender Rocker mit proto-punkigen-Garage-Kern und schillerndem Kostüm auch nur bedingt besser, weil die kurzweilig unterhaltsame Nummer zwar jammende Extase sein will, aber die in Aussicht gestellte Intensität nur bedingt auf den Hörer übertragen kann, stattdessen eher monoton dahinlaufendes Mäandern als fesselnde Hypnose bleibt.
Zumindest die erste Hälfte von Destroyer ist somit gelungen, aber vor allem frustrierend. Weil die Klasse von Black Mountain praktisch permanent spürbar ist, sie aber nie wirklich greifbar wird und sich allerorts Elemente finden, die der Euphorie gleich vollends im Weg stehen.
Bean verkennt durch die relative Rock-Fokusierung ein wenig ihre eigentlichen Stärken seiner „Band„, positioniert die Gewichtungen jedenfalls für den Moment definitiv falsch, weil ihm aktuell der inspirierende Reibungspunkt im Gefüge fehlt, um das Songwriting hinter der Ästhetik mit spannender Ambivalenz und substantieller Tiefe zu füllen. Letztendlich sind es so nicht nur die liebgewonnenen Trademarks der Band, die das bisher nichtsdestotrotz schwächste Album der Discografie mit Fanbrille in die nächsthöhere Wertungskategorie retten müssen, sondern einige entwaffnende Einzelmomente und durchwegs gelungene Highlights.
Das wunderbare Pretty Little Lazies verbindet mit hippiesken Akustikgitatarren die Screaming Trees mit Pink Floyd, hat eine rumpelnde Leichtigkeit und subtiles Melodiegespür. Die rückwärts ablaufenden Streicher betonen das zeitlos-anachronistische Flair und wenn Tempo und Dringlichkeit anziehen, um Captain Future gniedeln und plötzlich doch alle am Lagerfeuer sitzen, um orientalische Psychedelik zu betrachten, wirkt das in seiner progressiven Unberechenbarkeit dennoch rundum organisch und stimmig.
Der abgedämpft groovende Bass und das Schlagzeug in Boogie Lover sind dagegen stoisch und cool, ein bisschen wie Lux Prima in fieser verführerisch, wie Black Mountain da kontrolliert lauern. Zwar kommt die Nummer an sich kaum in Gang, hat aber eine großartig verruchte Atmosphäre und jeder Schub ist befriedigend. Licensed to Drive greift dann Closer to the Edge auf, spielt seine Riffs energisch, macht Laune und mehr noch trotz einer nur im Momentum zündenden Durchschaubarkeit klar, wohin der Sprudel Destroyer bringen hätte können. Stattdessen servieren McBean und Co. mit FD 72 eine offenkundige Bowie-Wave-Verbeugung in spacigen Welten und dramatischem Abschluß, der assoziativ greift, aber ereignislos verpufft.
Denn das fünfte Album der Band, es mag in ständiger Bewegung sein und seine Reise eilig angehen – doch kann es dabei nicht verbergen, dass McBean eigentlich kein Ziel hinter dem angepeilten Horizont hat und trotz klarer Verortung ein wenig orientierungslos umherbrettert. Für den Augenblick reicht das als unbekümmerter Roadtrip gerade noch für die routinierten Standards der Band.

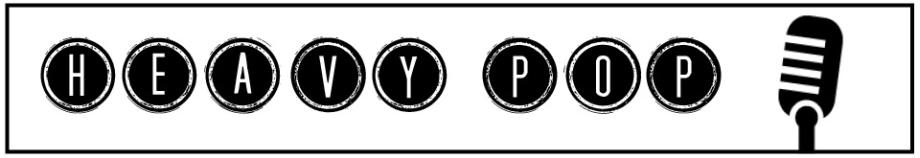
Kommentieren